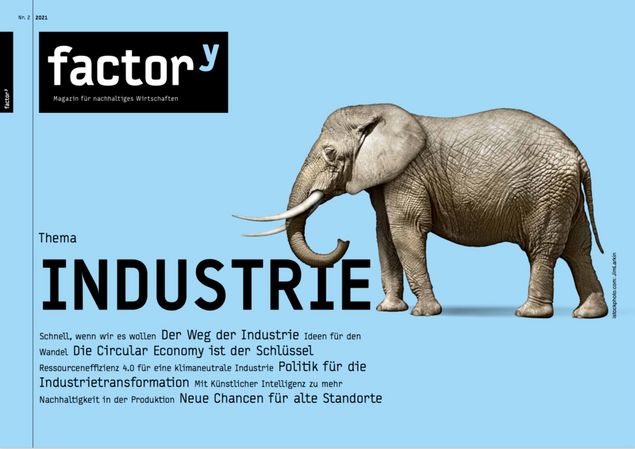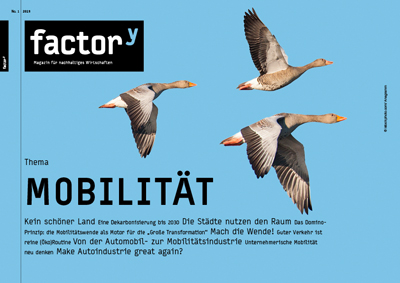Der Verkehrssektor ist einer der Bremser einer wirkungsvollen Emissionswende in Europa. Das gilt nicht nur im Automobilland Deutschland mit einer mächtigen Automobilindustrie, sondern auch in den meisten anderen Ländern Europas.
Klimaneutralität lässt sich so nicht erreichen, eine Antriebswende ist ebenso erforderlich wie eine Anpassung der Infrastruktur und der Industrie. Möglichkeiten, dies über nahezu kostenneutrale Fördersysteme zu erreichen, gibt es.
Aber das Interesse, diese einzusetzen, ist in Politik und Wirtschaft gegenwärtig gering. Trotz auch in Europa stärker werdender Klimawandelfolgen und steigender Verluste gibt es eher einen “Rollback” und die Forderung, strategische und rechtliche Voraussetzungen für die zukunftssichernde Zielerreichung auszusetzen.
So plädieren Autoindustrie und maßgeblich die autoproduzierenden Länder für eine Aufweichung der weiteren Reduzierung der Flottengrenzwerte, für eine Abkehr vom so genannten Verbrenner-Aus für Neuzulassungen von Pkw ab 2035 – mit dem Argument der Sicherung von Gewinn, Standorten und Arbeitsplätzen.
Eine Million Arbeitsplätze in Gefahr
Doch dieser Rückschritt und eine fehlende fortschrittliche Industriepolitik seien die größten Gefahren für die Verluste in der europäischen Automobilwirtschaft. Bis zu einer Million Jobs könnten verloren gehen und über zwei Drittel der geplanten Investionen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des europäischen Thinktanks Transport & Environment.
Fortschrittliche Politk könnte dagegen sogar wieder zu “alter Größe” führen: Bis zu 16,8 Millionen Fahrzeuge pro Jahr könnte Europas Autoindustrie produzieren, das entspräche dem Höchststand nach der Finanzkrise 2008.
Dafür müsste die EU allerdings an ihrem Ziel für emissionsfreie Neuwagen ab 2035 festhalten und ihre Industrie- sowie Nachfragepolitik verbessern. So ließe sich auch die Zahl der Jobs in der automobilen Wertschöpfungskette auf dem heutigen Niveau halten.
Positive Wirkungen progressiver Industriepolitik …
Die Studie modelliert die positiven Auswirkungen der EU-Flottengrenzwerte sowie der Umsetzung neuer industriepolitischer Maßnahmen zur Förderung der regionalen E-Auto-Produktion. Sie kalkuliert ebenso mit Elektrifizierungszielen für Unternehmensflotten und Unterstützung für in der EU hergestellte Autos und Batterien.
Unter diesen Voraussetzungen würde der Beitrag der automobilen Wertschöpfungskette zur europäischen Wirtschaft bis 2035 im Vergleich zu heute um 11 Prozent steigen.
…vs. negativer durch rückwärtsgewandte
Dagegen würde ein Aufweichen der CO2-Flottengrenzwerte und das Ausbleiben entsprechender industriepolitischer Maßnahmen dazu führen, dass die wirtschaftliche Leistung der europäischen automobilen Wertschöpfungskette bis 2035 um 90 Milliarden Euro schrumpft.
"Im Vergleich zu heute könnte es zu einem Verlust von bis zu eine Million Arbeitsplätzen kommen", so die Studie. Bis zu zwei Drittel der geplanten Batterieinvestitionen in der EU könnten ebenfalls verloren gehen, während der Ladeinfrastrukturbranche in den nächsten zehn Jahren potenzielle Einnahmen in Höhe von 120 Milliarden Euro entgingen.
Transformation unterstützen statt zu verlieren
Die Empfehlungen des Thinktanks sind deutlich: Die neue Bundesregierung und die EU sollten die Arbeitsplätze in der deutschen und europäischen Automobilindustrie sichern und Investitionen anregen, indem sie mit klima- und industriepolitischen Maßnahmen die Transformation zur E-Mobilität unterstützen:
- Die Beibehaltung der CO₂-Flottengrenzwerte für Pkw für 2030–2035 im Rahmen des bevorstehenden Reviews, flankiert von EU-weiten Maßnahmen zur Stärkung der Nachfrage.
- Produktionshilfen für Batterien in EU- und nationalen Förderprogrammen, kombiniert mit Anreizen zur Nutzung von Komponenten und Materialien aus europäischer Herstellung.
- Die Umsetzung der Verordnung über den Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR), Reformen des Strommarkts sowie Aktionspläne für Netze, um den Ausbau von Ladeinfrastruktur, Netzanschlüssen und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
- Die Verankerung sozialer Auflagen für gute Arbeitsbedingungen („Social Conditionality“) als Standard sowie die Stärkung von Regelungen für Technologie- und Wissenstransfer im Bereich ausländischer Direktinvestitionen.
Automobilwirtschaft, aber anders: Wie sich eine sozial-ökologische Automobilwirtschaft an den Standorten aufbauen lässt (im factory-Magazin “Hürden”).
Gerecht anregen: Hohe Klimaschutzwirkung, gerechte Teilhabe und Sicherung der deutschen Automobilwirtschaft durch den richtigen Instrumenten-Mix.
Emissionswende, aber gerecht: Ab 2027 steigt der C02-Preis für Kraft- und Heizstoffe. Mit gestaffeltem Klimageld wäre Akzeptanz garantiert.
Anders erzählen: Keine Angst vor Wandel und Maßnahmen für mehr Klima- und Ressourcenschutz. Wie Politik und Wirtschaft kommunizieren müssten (factory-Magazin “Hürden”).
Schrumpfen und Wachsen: Mehr Umsatz und Beschäftigung in der Fahrradwirtschaft, zunehmend weniger in der Automobilindustrie bei höherem Ressourcenverbrauch.
E-Auto vs. E-Fuels-Verbrenner: Gegenüber Pkw, die synthetische Kraftstoffe nutzen – so genannte E-Fuels, die klimaneutral produziert würden –, wäre die Energie- und Umweltbilanz von E-Autos doppelt so gut.