Handeln
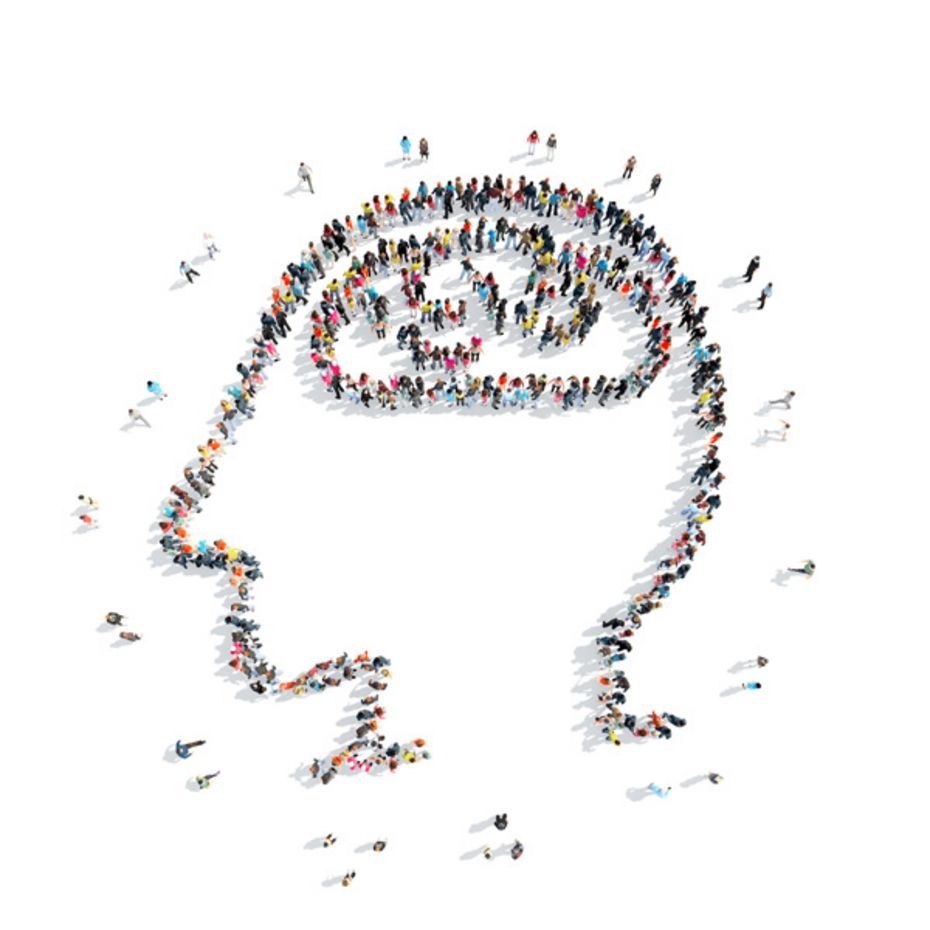
Die Deutungshoheit über die Zukunft haben jetzt die klimaschutzorientierten Unternehmen
sagt Dirk Messner, der sich mit dem Klimawissenschaftler Hans Joachim Schellnhuber den Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) teilt. Ralf Bindel sprach mit Messner über die wichtigsten Akteure für den Klimaschutz, über Migration und Handelsabkommen.
factory: Das Pariser Klimaschutzabkommen wird wahrscheinlich Geschichte machen – unabhängig vom Erfolg seiner Umsetzung. Die internationalen Klimaverhandlungen werden in den nächsten Jahren weiter gehen. Wen sehen Sie über die Klimaverhandler hinaus als maßgebliche Akteure in Sachen Klimaschutz und Dekarbonisierung?
Dirk Messner: Ich würde sagen, neben den Staaten, die national und international für Ordnungspolitiken sorgen müssen, die auf eine sukzessive Dekarbonisierung unserer Ökonomien hinauslaufen, gibt es fünf relevante Akteure, die einen großen Beitrag leisten zu dem gesamten Prozess in Richtung klimaverträglicher Gesellschaft. Als erstes sind da die Unternehmen. Was tun die Unternehmen und wie weit betreiben sie in Eigeninitiative Anstrengungen zu reduzieren? Wir haben innerhalb der Wirtschaft auch Clubs von Unternehmen, die da sehr anspruchsvoll sind. In Deutschland gibt es z. B. die Zwei-Grad-Initiative der deutschen Wirtschaft, das sind Unternehmen, die freiwillig größere Beiträge leisten wollen, ihre Emissionen zu reduzieren. Unternehmen sind sehr wichtig, die Wirtschaft ist wichtig. Die zweite wichtige Akteursgruppe ist eine Untergruppe der Wirtschaft, die Finanzunternehmen und Finanzakteure. International bekannt ist inzwischen eine Bewegung, die nennt sich Divestment. Dahinter verbirgt sich, dass Anleger – das können Kleinanleger sein wie Sie und ich, aber auch Banken oder wie vor kurzem die Allianz-Versicherung – ihre Anlagen und Investitionen bei Unternehmen einstellen, die im fossilen Bereich tätig sind und diese Investitionen umlenken in nachhaltige Bereiche wie erneuerbare Energien.
Ist Divestment wirklich so stark? Ursprünglich war es eine Forderung von Umweltschützern, Studierenden und NGOs.
Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Die Divestment-Bewegung schien am Anfang die charmante Idee einiger weniger Idealisten zu sein, aber mittlerweile bewegen sich große Unternehmen wie eben die Allianz in eine solche Richtung. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Weltbank, große internationale Finanzierungsinstitutionen, das ist die zweite große Akteursgruppe.
Wir sind gespannt auf die weiteren.
Der dritte große Akteur sind Städte. In Städten entstehen 60 bis 65 Prozent der energiebezogenen Emissionen. Wie Städte sich weiterhin entwickeln ist deswegen sehr wichtig – und es gibt Städte, die da sehr ambitioniert vorgehen. Die vierte Gruppe sind Nichtregierungsorganisationen, die Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben, auf das Problem aufmerksam machen. Und der fünfte Akteur ist für mich die Wissenschaft. Wir als Wissenschaftler haben ja auch eine wichtige Rolle, denn wir können einerseits analysieren, wie der ganze Prozess sich überhaupt vollzieht, ob die Emissionsreduzierungen reichen, die da jetzt entstehen, und wir können Hinweise geben, wie man Probleme löst.
Ist das auch die Reihenfolge des Impacts, der Bedeutung? Unternehmen tatsächlich an erster Stelle und dann Divestment?
Wenn ich hundert Prozent Impact unter den fünf Akteuren aufteilen müsste, würde ich Unternehmen und Finanzinstitutionen zusammen schon 50 Prozent geben. Bewegen sich diese beiden in die richtige Richtung, ist das von herausragender Bedeutung. Deswegen bin ich auch vorsichtig optimistisch, denn in den letzten fünf Jahren hat sich da unglaublich viel getan. Wenn man sich die globalen Neuinvestitionen im weltweiten Energiebereich anschaut, hatten wir 2003/2004 eine Aufteilung dieser Investitionen zu 80 Prozent in fossile und nukleare und 20 Prozent in erneuerbare Energien. Mittlerweile nehmen die Erneuerbaren über 50 Prozent ein. Seit 2012/-13/-14, seit drei Jahren in Folge, registrieren wir, dass die weltweiten Neuinvestitionen im Energiesektor zu mehr erneuerbaren Energien führen als zu solchen, die fossil oder nuklear basiert sind. Das ist eine unglaubliche Veränderung, die Neuinvestitionen haben bereits einen Kipp-Punkt in Richtung Dekarbonisierung erreicht. Die anderen Akteure Städte, NGO, Wissenschaft haben wichtige Rollen, aber dass Unternehmen in diese Richtung steuern, ist herausragend. Weil sich am Ende des Tages dort entscheidet, ob ein Großteil der Emissionsreduzierungen umsetzbar ist.
Die Unternehmen sind die tatsächlichen Erzeuger bzw. Hauptverbraucher von Energie. In der Witschaft entscheidet sich, wie viel und welche Energie und Ressourcen in Produkten und Dienstleistungen stecken.
In der Tat. Die Städte stellen eher die Nachfrageseite. In der Stadt konsumieren wir die Energie, dort brauchen wir sie für Wärme oder zur Kühlung. Die Unternehmen sind sozusagen die Angebotsseite, da wird die Infrastruktur verändert, die Anlagen, da entstehen neue Mobilitäts-, neue Energiesysteme.
Wir sehen jetzt, dass es zu einem Divestment kommt, zwar global in einem noch geringen Umfang, denn es sind ja nur wenige Prozentpunkte, die Allianz und Co. dort bisher ausmachen, aber natürlich ist es ein guter Weg. Die vermeintlich schwächeren Akteure NGOs und Wissenschaft sind dennoch die einzigen, die in der Vergangenheit auf eine politische Rahmenveränderung gedrängt haben. Unternehmen haben sich da zurückgehalten oder sogar dagegengehalten, Städte ebenfalls. Könnte das in Zukunft anders sein, so dass durchaus sogar strengere Rahmensetzungen zur Dekarbonisierung durch diese Akteure von der Politik verlangt werden?
Es gibt ja Unternehmenszusammenschlüsse, Clubs oder Gruppen von Unternehmen, die die Politik auffordern oder auch die Klimaverhandler auffordern, ambitionierte Ziele umzusetzen, beispielsweise eine globale Carbon Tax durchzusetzen. Geht ein Unternehmen in diese Richtung, kann dieser Schritt auch Wettbewerbsnachteile bedeuten. Insofern sind diese Unternehmen daran interessiert, dass gleiche Regeln für alle gelten. Die Unternehmen, die ambitioniert sind und ihre Unternehmens- und Geschäftsmodelle darauf ausgerichtet haben, schnell Emissionen zu reduzieren, haben ein Interesse daran, dass wir auch eine entsprechende Regulierung bekommen. Die Weltbank hat z. B. 1000 große Unternehmen zusammengebracht, die die internationale Staatengemeinschaft und die Klimagipfel auffordern, eine globale Carbon Tax zu vereinbaren. Die deutsche Zwei-Grad-Initiative der Wirtschaft unterstützt und berät die deutsche Regierung dabei, ambitionierte statt schwache Klimaziele zu verfolgen. Insofern gibt es da eine Dynamik von Unternehmen, die sich bewegen.
Ich bin etwas überrascht, dass Sie die Unternehmen tatsächlich so hoch bewerten als Zwei-Grad- oder sogar 1,5-Grad-Ziel-relevanten Akteur. Denn in der Vergangenheit hat sich die Mehrzahl der Unternehmen gegen Einsicht und Rahmensetzungen gewehrt – da können Sie sich alle großen Wirtschaftsverbände anschauen. Eher war Klimaschutz eine Art Schmuckelement für wenige. Diejenigen, die es erkannt haben und in Effizienzmaßnahmen investieren, sehen es sicher als Sicherung von Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit.
Meine Beobachtung ist, dass sich da die Perspektiven verschoben haben. Der Energiebereich ist der wichtigste Bereich, der fokussiert werden muss, wenn man über eine dekarbonisierte Weltwirtschaft sprechen will, weil 70 Prozent der globalen Emissionen aus dem Energiesektor stammen. In vielen Ländern sieht es nicht viel anders aus als bei uns: Die klassischen fossilen Unternehmen stehen unter großem Anpassungsdruck und wir sehen weltweit, dass seit 2012 die Mehrzahl der Neuinvestitionen im erneuerbaren Energiebereich getätigt werden. Das Zukunftsmodell des Weltenergiesystems, das deutet sich jetzt an, wird erneuerbar sein, und die fossilen Investitionen sind auf dem Rückzug. Da hat sich ein sehr radikaler Wandel vollzogen. Ich würde das unter der Chiffre zusammenfassen: Die Deutungshoheit über die Zukunft haben jetzt die klimaschutzorientierten Unternehmen. Die noch nicht auf der Spur sind, versuchen natürlich, von der Regierung Zeit zu kaufen, energieintensive Unternehmen, deutsche Stahlhersteller beispielsweise. Man findet jedoch nur noch sehr wenige Unternehmer, die sich auch öffentlich zu sagen trauen, Klimaschutz ist ein Prozess, den wir hier blockieren wollen. Bestenfalls finden Sie Akteure – ich bin ja nicht naiv – die durch Lobbying versuchen, mehr Zeit zu kaufen für den Umbauprozess. Aber dass sich die Weichenstellung in Richtung klimaverträgliches Wirtschaften vollziehen muss, darüber gibt es große Einigkeit. Nicht nur in Europa, sondern weltweit gibt es diese Entwicklung.
Apropos Entwicklung. Wie sieht es denn in den Ländern aus, in denen die jetzigen Werkbänke der Welt stehen, also in Asien? China und Indien gelten als Schwellen- und/oder Entwicklungsländer mit den nominell und potenziell größten Emissionen, da sie so bevölkerungsreich sind.
China und Indien sind zwei unterschiedliche Fälle, wenn man sie aus der klimapolitischen Perspektive betrachtet. Es ist ganz richtig, dass ein beachtlicher Teil der industriellen Produktion in China stattfindet. Dort sind die Emissionen nicht nur nominell sehr hoch – es sind ja auch immerhin 1,3 Milliarden Menschen – sie sind auch pro Kopf inzwischen sehr hoch. Vor gut einer Dekade lagen sie noch bei etwa 2,5 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr, in Deutschland lagen sie zu dem Zeitpunkt bei ungefähr 10 Tonnen. China hat jetzt aufgeschlossen zu Europa. Hier senken wir leicht ab, sind im Augenblick bei 8 Tonnen pro Kopf und wollen weiter reduzieren, China ist jetzt bei 8 Tonnen angekommen, die Emissionen sind also stark angestiegen. In Indien sind die Pro-Kopf-Emissionen immer noch bei gut zwei Tonnen, also weit entfernt von unserem Niveau, um den Faktor 4 geringer.
Macht China zu wenig, um den Anstieg zu drosseln?
Zu China muss man sagen, dass natürlich noch ein großer Teil der Energieversorgung fossil basiert ist, aber auch dort zeichnet sich ab, dass die Neuinvestitionen im erneuerbaren Energiebereich angesiedelt sind. China sieht sich sogar als die Wirtschaft, die am schnellsten in der Lage ist, diese Technologien in die Breite zu tragen, denn China verfügt über beachtliche Devisenreserven, das zu finanzieren. Wenn ich in China bin, erzählt man mir dort mit einem Schmunzeln, dass China sich den Wandel leisten kann, während in Europa allenfalls Deutschland dazu in der Lage ist, die anderen Länder aber wegen der Verschuldungsproblematik kaum. China sieht sich als Dekarbonisierungsinnovator.
Und in Indien?
Dort lautete die Diskussion noch vor drei bis vier Jahren, dass der Klimawandel ein Problem der Industrieländer ist, das von ihnen erzeugt wurde und wird und deswegen auch von ihnen gelöst werden muss. Indien sah sich da nicht in der Pflicht. Das Land wird zunächst auch weiter auf traditionelle Konzepte von Wachstum, Beschäftigung und Armutsbekämpfung setzen, Klimabezüge haben da noch eine nachgeordnete Bedeutung. Der Diskurs hat sich aber dennoch gedreht in den letzten drei Jahren. Positive Signale sind, dass das Land große erneuerbare Energieprogramme aufsetzt. Das ist sehr sinnvoll, denn Indien hat große Potenziale im Sonnen- und Windenergiebereich und beginnt jetzt, diese auch tatsächlich zu nutzen. Und: Indien hat das ambitionierte Parier Klimaabkommen, dass auch Entwicklungs- und Schwellenländer in die Pflicht nimmt, nicht blockiert – da habe ich mir zuvor große Sorgen gemacht. Das könnte alles noch schneller gehen, aber China und Indien bewegen sich zumindest in die richtige Richtung.
Ist in China auch so eine Art unternehmerischer Aufbruch oder ein neues Bewusstsein für Klimaschutz zu spüren, ähnlich dem in den westlichen Ländern?
Also die Diskussion in der chinesischen Wirtschaft ähnelt, wenn Sie mit Industriellen reden, der in Deutschland. Von einem Teil wird das als neues Innovationsfeld gesehen, als neue Welle mit großen, grünen Investitionen in neue Infrastrukturen und neuen Geschäftsfeldern. So wie Sie das hier auch hören, in Energieeffizienz- oder Umweltunternehmen oder überall dort, wo es um Energie- und Ressourceneffizienz geht. Dann haben Sie auf der anderen Seite die Unternehmer, die im traditionellen energieintensiven Bereich arbeiten. Auch dort ist es die Stahl- und Zementindustrie, die Automobilindustrie. Wie hier wird dort auch versucht, Zeit zu kaufen. Aber es gibt drei wichtige Treiber einer Klimaorientierung. Der erste ist das Wissen um die naturräumlichen Auswirkungen des Klimawandels in China, also schrumpfende Wasservorräte, degradierende Böden, steigender Meeresspiegel an der gesamten Ostküste. Die Vulnerabilität Chinas gegenüber dem Klimawandel ist ein großes Thema. Zurecht, denn die Folgen werden dort viel massiver ausfallen als beispielsweise in Europa. Der zweite wichtige Treiber ist eher ein innenpolitischer. Ich glaube, dass wir den schnellsten Trend in Richtung E-Mobilität in China sehen werden, weil die Luftverschmutzung so unglaublich massiv ausfällt und die Partei große Sorgen um ihre Legitimation und Macht hat. Die Menschen wollen einfach nicht mehr akzeptieren, dass die Kinder nicht mehr frei atmen können. Deswegen wird sehr massiv in den Ausbau neuer Mobilitätsinfrastrukturen im Elektromobilitätsbereich investiert. Dieser zweite Treiber ist also eher Gesundheits- als Klimaschutz, wird aber dazu einen Beitrag leisten. Und das dritte Argument ist immer die starke Außenpolitik in China. Ich hatte kürzlich dazu ein Gespräch mit dem stellvertretenden Außenminister und er sagte: "Naja, wir sind ein großes Land, wir haben großen internationalen Einfluss, und jede globale Macht braucht eine Geschichte, die sie der Welt erzählt. Die amerikanische Erzählung ist Demokratie und Freiheit. Unsere wird sein, dass wir Armutsbekämpfung und Ressourcen- und Nachhaltigkeitsfragen zusammenbringen. China ist ein Entwicklungsland, noch immer, es verfügt über wenige Ressourcen und ist vulnerabel gegenüber Umweltveränderungen. Wir bringen Armutsbekämpfung und Ressourcenfragen zusammen. Das ist unsere soft power-Strategie." Das bildet in etwa die Diskussion in China ab.
Trotz der spürbaren Probleme ging laut Kohlemarktbericht der Internationalen Energieagentur in China 2014 noch jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz.
Aber es geht auch alle paar Tage ein altes Kraftwerk vom Netz. Die Kraftwerke, die jetzt gebaut werden, sind die der jüngsten technischen Generation. Mir wäre auch lieber, es würde keines mehr gebaut. Dennoch steigt die Zahl der Erneuerbaren Energiequellen in China seit vier Jahren sehr, sehr schnell. Die Kohle wird entsprechend zurückgefahren, weil die Erneuerbaren so schnell wachsen. Geplant hatte die chinesische Regierung bis 2030 beim Energieausbau zunächst vor allem Kohleverbrennung, doch jetzt stammt ein beachtlicher Teil an Energieentwicklung aus erneuerbaren Quellen. Das ist eine wichtige Veränderung, die vor etwa drei Jahren eingeleitet wurde. Ob die schnell genug passiert, damit wir innerhalb des Zwei-Grad-Korridors bleiben, das müssen wir erstmal abwarten. Aber China hat sich immerhin vorgenommen, bis 2020 den Peak zu erreichen, den Höhepunkt der Emissionen, die durch Kohleverbrennung zustande kommen, danach soll sie heruntergefahren werden, ab 2030 sollen die Emissionen insgesamt reduziert werden. Zudem baut China nun ein Emissionshandelssystem auf. Das entsprechende europäische System zu modernisieren und diese beiden dann zu verkoppeln, könnte große Impulse zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft leisten und dazu beitragen, im Klimaschutz ein level playing field zu schaffen – das würde auch den europäischen Unternehmen helfen.
Was sie skizzieren ist das Paket, das China als freiwillige Verpflichtung in die Pariser Klimaverhandlungen eingebracht hat?
Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass China das schneller erreichen wird, aber die Regierung vertritt nach außen Ziele, von denen sie weiß, dass sie sie sicher schaffen kann. Und auch das ist eine wichtige Veränderung. Ich arbeite jetzt seit zehn Jahren intensiv in China, ich bin Mitglied eines Gremiums, dem China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED). Darin sind zehn chinesische und zehn internationale Experten, die die chinesische Regierung in Umwelt- und Wirtschaftsfragen beraten. Noch vor wenigen Jahren war es ein Tabu, über den Peak von Emissionen zu reden. Mittlerweile bewegt sich das Land massiv in diese Richtung. Deshalb sind die beiden wichtigsten Wettbewerber für Deutschland, wenn es um Effizienz-Technologien und Energieinfrastruktur im Bereich der Erneuerbaren geht, China auf der einen und die USA auf der anderen Seite, weil auch dort diese Technologien stark ausgebaut werden.
Bis zu diesem Abschnitt ist das Interview auch im factory-Magazin Handeln zu lesen. Weiter geht es auf der nächsten Seite mit der Verantwortung gegenüber den armen Ländern, der nachhaltigen Planung der weiteren Urbanisierung, dem Zusammenhang zwischen Migration und Klimawandel und der Integration von Klimaschutz in internationale Handelsabkommen, wie sie auch in diesem Magazin im Beitrag von Alessa Hartmann behandelt werden.
-> nächste Seite
Beiträge online
News zum Thema
- 10/2024 | Living Planet Report 2024: Inzwischen 73 Prozent weniger Wirbeltiere
- 09/2024 | EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte: Verschiebung ohne Mehrwert für Wirtschaft
- 02/2024 | Leitfaden zum Klimaschutz an Schulen
- 11/2023 | Öl- und Gaskonzerne könnten für Klimaschäden zahlen und dennoch profitieren
- 05/2023 | UN: Schutz der biologischen Vielfalt zügig umsetzen
- 04/2023 | Europa 2022: Rekorde bei Hitze, Trockenheit und Gletscherschmelze
- 03/2023 | "Letzte Warnung" des IPCC: Schnelle Emissionsreduktion nötig – und möglich
- 01/2023 | Sechs-Punkte-Plan für Gutes Essen für alle
- 01/2023 | Lützerath: Aktionen und Demonstrationen gegen weiteren Braunkohleabbau
- 01/2023 | Lieferkettengesetz: Sorgfalt ist nun Pflicht
- 12/2022 | EU einigt sich auf Gesetz gegen Entwaldung für bestimmte Produkte
- 11/2022 | UN-Klimagipfel COP 27: Geplante Maßnahmen reichen nur für 2,5 Grad
- 10/2022 | Living Planet Report 2022: Biologische Vielfalt weiter reduziert
- 09/2022 | Globaler Klimastreik für #PeopleNotProfit
- 09/2022 | Schnelle Dekarbonisierung des Energiesystems spart Billionen
- 08/2022 | Abkommen zum Schutz der Hohen See erneut gescheitert
- 08/2022 | Verpackungsleitfaden für Unternehmen
- 08/2022 | Mit Übergewinnsteuer Krisenprofite umverteilen
- 08/2022 | UN-Staaten verhandeln über den Schutz der Hochsee
- 08/2022 | Ressourcen schützen heißt Menschen schützen
- 06/2022 | Derzeitige Klimaziele bis 2030 führen zu 2,4 Grad globaler Erwärmung
- 04/2022 | Industrienationen müssten Fleischkonsum um 75 Prozent senken, um Öko- und Wirtschaftssysteme zu erhalten
- 04/2022 | IPCC-Klimabericht zur Minderung des Klimawandels vergleicht Klimaschutzmaßnahmen und ihre Effizienz
- 03/2022 | Strukturen bremsen Geschlechtergerechtigkeit weiterhin
- 01/2022 | Entwaldungsfreie Lieferkette: EU-Gesetz fördert Verlagerung der Produktion in ebenso schützenswerte Ökosysteme
- 01/2022 | EU-Taxonomie für Investitionen: Atom- und Gaskraftwerke sollen nachhaltig sein
- 11/2021 | Ernährung, Gesundheit und Klima zusammendenken
- 11/2021 | Eine Industrieregion will klimaneutral werden: Die "zeero-days" zeigen wie
- 10/2021 | Klimaschutzpläne für Glasgow-Gipfel ungenügend: Regierungen planen doppelt so hohe fossile Verbrennung
- 10/2021 | UN Biodiversitätsgipfel: Wird Kunming zum Paris des Artenschutz?
- 10/2021 | Hoch klimaschädliche Methanemissionen mit Methanabgabe reduzieren
- 09/2021 | Scheinlösungen führen nicht zu mehr Klimaschutz
- 09/2021 | Die leichte Entscheidung bei der Klimawahl
- 08/2021 | So kann das Ruhrgebiet zur grünsten Industrieregion der Welt werden
- 08/2021 | IPCC-Bericht: Für 1,5 Grad-Szenario müssen die globalen Emissionen in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte fallen
- 07/2021 | Für mehr Vielfalt auf dem Teller
- 06/2021 | Bürgerrat Klima präsentiert Maßnahmen zur Erreichung des Pariser 1,5-Grad-Ziels
- 06/2021 | Zentralbank will Investitionen der Banken nach Klimakriterien
- 06/2021 | Risiken der Erderhitzung für Deutschland: Nur mit schnellen Maßnahmen zu begrenzen
- 06/2021 | Verantwortungsvolle Produktion: Bundestag beschließt Lieferkettengesetz mit Lücken
- 02/2021 | Abbau von klimaschädlichen Subventionen führt zu mehr sozialer Gerechtigkeit
- 12/2020 | Düsteres Bild: Die Vielfalt der Pflanzen in Deutschland geht deutlich zurück
- 12/2020 | Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2020 mit Liveübertragung und virtuellem Kongress
- 11/2020 | Klimaneutrales Deutschland in drei Schritten bis 2050
- 10/2020 | Gut gemachte Klimaschutzpolitik ist auch sozial erfolgreich
- 10/2020 | Wie Deutschlands Energiesystem bis 2035 CO2-neutral und das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann
- 10/2020 | Artenverlust wirkt direkt auf das Leben der Menschen
- 09/2020 | UN-Ziele zur Biodiversität: Nach zehn Jahren keines der Ziele erreicht
- 08/2020 | CO2-Bilanzierungstool ecocockpit in neuer Version online
- 07/2020 | Klimaschutz: Wer nicht schneller und mehr reduziert, überlässt die Schulden zukünftigen Generationen
- 07/2020 | Lieferkettengesetz: Unternehmen müssen ihre globale Produktion sozial und menschengerecht gestalten
- 07/2020 | Bundestag beschließt Gesetze zum Kohleausstieg bis 2038: Für Pariser Klimaziele wäre ein Ende bis 2030 nötig
- 06/2020 | EU-Handelsabkommen Mercosur soll Fleischimporte und Automobilexporte verstärken, Menschenrechte aber nicht berücksichtigen
- 04/2019 | Deutschlands Klimabilanz 2018: Wegen warmer Witterung 4,2 Prozent weniger Treibhausgasemissionen
- 03/2019 | Weltweit steigender Ressourcenverbrauch treibt Klimawandel und Artenverlust
- 03/2019 | Globale UN-Vereinbarung gegen Plastikmüll gefordert
- 02/2019 | Ranking der Nachhaltigkeitsberichte: KMU und Großunternehmen berichten besser über Lieferketten
- 01/2019 | Agrarpolitik: Subventionen für das Falsche
- 12/2018 | Klimaschutz selbermachen: Energieverbrauch prüfen und senken
- 11/2018 | Doppeldemo für schnelleren Klimaschutz
- 11/2018 | Wie sich das Klimaziel 2030 sicher erreichen lässt
- 11/2018 | Was haben Bits mit Bäumen zu tun?
- 09/2018 | Hambacher Wald: Mehrheit der Bevölkerung ist für den Erhalt
- 09/2018 | Ressourceneffizienz: Die nächsten 20 Jahre
- 08/2018 | Insektenplagen schädigen mit wachsendem Temperaturanstieg mehr Ertrag
- 08/2018 | Nur ein schneller Kohleausstieg in NRW sichert das deutsche Klimaziel für 2030
- 08/2018 | Klima-Nothilfeplan für rasches Handeln
- 08/2018 | Erderwärmung könnte in neue „Heißzeit“ führen, weil Rückkopplungen Effekte verstärken
- 07/2018 | Kohleausstieg hat nur geringe Auswirkungen auf Arbeitsplätze
- 07/2018 | Lebensmittelimporte - eine schwere Bürde für arme Länder
- 07/2018 | Ressourceneffizienz in Wertschöpfungsketten: Da geht viel mehr
- 06/2018 | Ein Tag des guten Lebens für alle
- 06/2018 | Besser essen auf großen Events
- 05/2018 | Carbon-Footprint für Unternehmen: CO2-Bilanzierung mit dem ecocockpit
- 05/2018 | Arbeit hat viele Facetten: Der Atlas der Arbeit zeigt sie
- 04/2018 | Tag des Baumes: Deutschland lässt seine Wälder leiden und sorgt global mit für Waldzerstörung
- 04/2018 | Gasproduktion mit Ökostrom wird in wenigen Jahren günstiger als fossiles Erdgas
- 04/2018 | Fallende Preise lassen die Erneuerbaren Energien weltweit wachsen
- 03/2018 | CSR-Berichtspflicht verlangt mehr Transparenz von großen Unternehmen
- 03/2018 | Energiewende: Deutschland im internationalen Vergleich hinten
- 03/2018 | Mehrheit will Stilllegung alter Kohlekraftwerke – Kohlekommission muss gesellschaftliche Interessen abbilden
- 03/2018 | Deutschland will Menschenrechte nicht vor Wirtschaft schützen
- 03/2018 | Große Koalition kann Klimaziele mit ambitioniertem Fünf-Punkte-Plan noch schaffen
- 03/2018 | Cargobikes: Bund fördert Kauf von Schwerlasträdern mit bis zu 2500 Euro
- 02/2018 | Mit dem Rad zu Verkehrswende und Stadtwandel
- 02/2018 | Dauerhafter Meeresspiegel-Anstieg um mehrere Meter, wenn sich die Emissionswende weiter verzögert
- 02/2018 | Bio wächst weltweit – aber Gesamtanteil gering
- 02/2018 | Ranking der Nachhaltigkeitsberichte und Monitoring der CSR-Berichtspflicht 2018 startet
- 01/2018 | Stromanbieter in Deutschland: Mehr schmutzige Kohle drin als angegeben
- 01/2018 | Industrie kann Klimaschutz verkraften
- 01/2018 | Satt ist nicht alles
- 01/2018 | Effizienzpreis NRW 2017: Produkt, Prozess oder Konzept?
- 12/2017 | Nachhaltigkeitsranking von Onlineshops zeigt große Unterschiede
- 11/2017 | Europa wird Klimaziele nur mit gemeinsamem Energiebinnenmarkt und regulatorischem Druck erreichen
- 11/2017 | Städte können mehr gegen den Klimawandel tun als gedacht
- 10/2017 | Deutliche Mehrheiten für Kohleausstieg und schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien
- 10/2017 | Sharing-Fahrdienste wie Uber und Lyft verdrängen öffentlichen Nahverkehr und umweltschonendes Verkehrsverhalten
- 10/2017 | Welternährungstag 2017: Mehr Hunger trotz Industrie. Kleinbauern stärken, Konzernmacht begrenzen, Lebensmittelsystem beenden – das wollen die NGO
- 10/2017 | Lasst die Wirtschaftswissenschaft transformativ werden
- 10/2017 | Klimagipfel-Berichterstattung: Kenntnis und Vertrauen wachsen um 20 Prozent
- 10/2017 | Europaweit eine Million Unterschriften gegen Glyphosat anerkannt
- 09/2017 | Ressourceneffizienz und Industrie 4.0: Best-Practice-Unternehmen kennenlernen
- 09/2017 | Klimaschutz nur mit Ende des Verbrennungsmotors
- 09/2017 | Deutschland verfehlt Klimaziel bis 2020 deutlich: Kohleausstieg und Verkehrswende erforderlich
- 09/2017 | Klimaschutz durch Remanufacturing: Den Hidden Giant entdecken
- 08/2017 | Verkehrswende: Deutschland kann bis 2035 emissionsfrei mobil sein
- 08/2017 | Fast 75 Prozent der Menschen in Deutschland wollen schnellen Kohleausstieg, um das Klimaziel 2020 zu erreichen
- 08/2017 | "Ganze Agrarlandschaften könnten vogelleer werden"
- 08/2017 | Festival Maker Faire macht kreativ und ressourcenleichter
- 08/2017 | Verkehr, Gas und Kohle sind die Treiber der steigenden deutschen CO2-Emissionen
- 07/2017 | Werteorientiertes Handeln unter fairen Partnern
- 07/2017 | Europa braucht strengere Grenzwerte für Lkw
- 07/2017 | Klimapolitik könnte ohne USA sogar besser funktionieren
- 07/2017 | Sharing für die Umwelt: Das Potenzial ist groß, das Angebot zu unbekannt
- 06/2017 | Der Staat (be)steuert falsch statt nachhaltig
- 06/2017 | 30-Hektar-Ziel: Flächenverbrauch für Wohnen und Verkehr liegt bei 66 Hektar pro Tag
- 06/2017 | GLS Bank fordert stärkere Kapitalbesteuerung, Grundeinkommen, CO2-Preis und Abgaben auf Spritz- und Düngemittel
- 06/2017 | Geht doch: Handelsketten produzieren Textilien mit weniger Gift – aber noch immer ohne Konzept zur Suffizienz
- 05/2017 | Was die Think-Tanks der Welt für die G20-Verhandlungen empfehlen
- 05/2017 | Effizienz-Preis NRW mit Preis für "junges" ressourcenschonendes Produktdesign
- 05/2017 | Nachhaltige Entwicklung geht nur mit gesunden Böden
- 05/2017 | Online-Kostenrechner zeigt, für wen sich ein Elektro-Auto lohnt
- 05/2017 | Neue Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 will die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele unterstützen
- 05/2017 | EU könnte globale Entwaldung durch ihre Agrarpolitik reduzieren
- 05/2017 | Ab heute kommen Lebensmittel nicht mehr in die Tonne
- 04/2017 | Breites Bündnis will nachhaltige Finanzreform
- 04/2017 | Deutschland kann und muss bis spätestens 2035 aus der Kohleverbrennung aussteigen
- 04/2017 | Bio-Lebensmittel in EU weit weniger pestizidbelastet als konventionelle
- 04/2017 | Deutsche wünschen sich starken Staat für besseren Umwelt- und Klimaschutz
- 04/2017 | KMU: Neue Ideen für Ressourceneffizienz fördern lassen
- 03/2017 | Gemeinwohl-Ökonomie, Kakao-Handel und Bildungsplattform für Geflüchtete ausgezeichnet
- 03/2017 | Kompetenz für nachhaltigen Konsum soll wachsen
- 03/2017 | Industrie und Umwelt: Wie geht es weiter im Industrieland NRW?
- 03/2017 | Gewissen und soziales Umfeld entscheiden über nachhaltige Geldanlage
- 03/2017 | Nachhaltigste Unternehmen, Forschung, Städte, Architektur und StartUps 2017 gesucht
- 02/2017 | Die Strompreise müssen die regionale Wahrheit sagen
- 02/2017 | Vorbildlich: Umweltfreundliches Catering im Bundesumweltministerium
- 02/2017 | Städtische Verkehrsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge wahrscheinlich
- 02/2017 | Schweizer Studie beleuchtet „Food Waste“
- 02/2017 | Studie: EU muss bis 2030 alle Kohlekraftwerke abschalten, um das Pariser Klimaziel zu erreichen
- 02/2017 | Getränkeverpackungssteuer soll Mehrweganteil erhöhen
- 02/2017 | Deutsche Bank finanziert weiter Kohlekraftwerke – über ihre Kunden
- 01/2017 | Deutsche wünschen sich mehr Förderung umweltfreundlicher Landwirtschaft
- 01/2017 | Für Pariser Klimaziel müssen alte Kohlekraftwerke vom Netz
- 01/2017 | Konzerne der Agrar- und Ernährungsindustrie werden größer und mächtiger
- 01/2017 | Agrarwende 2050 in Deutschland: Mit halbiertem Fleischkonsum zum Klimaziel
- 01/2017 | Umweltbundesamt zählt Mehrwertsteuervergünstigung für Fleischprodukte zu den umweltschädlichen Subventionen
- 12/2016 | Regionale und ökologische Versorgung geht auch in Ballungsräumen und Großstädten
- 11/2016 | Die utopischen Kräfte der Wissenschaft wecken
- 11/2016 | Klimafreundliche Stadtplanung ist der Schlüssel zum Zwei-Grad-Ziel
- 11/2016 | Deutschland verfehlt Klimaziel 2020: Erreichbar nur ohne Kohle
- 11/2016 | Mit dem Elektromotorrad nach Marrakesch
- 11/2016 | Ressourceneffiziente Produkte günstiger machen
- 11/2016 | Wandel trotz Trump und Gabriel
- 11/2016 | Klimakonferenz COP22: Deutsch-marokanische Verhältnisse
- 10/2016 | Das System Erde ist fast ausgebrannt
- 10/2016 | Europäische und Nationale Ressourcen-Foren vom 9. bis 11. November in Berlin
- 10/2016 | UN-Habitat III-Konferenz mit neuer urbaner Agenda ohne echte Beteiligung – aber mit Chancen
- 10/2016 | CO2-Steuern würden Emissionen und Ungleichheit senken
- 10/2016 | Investoren haben 26,7 Millionen Hektar Land übernommen
- 10/2016 | Preise für Ackerboden explodieren – Flächenversiegelung nimmt weiter zu
- 09/2016 | Unternehmen berichten zu wenig über ihre Lieferanten
- 09/2016 | Stop CETA und TTIP am 17.9. – Dezentrale Großdemo in sieben Städten
- 09/2016 | Unternehmen qualifizieren Geflüchtete: Sprachkurse reichen nicht aus
- 08/2016 | Ranking der Nachhaltigkeitsberichte 2015/2016: Ergebnisse am 23. September
- 08/2016 | Earth Overshoot Day 2016 wieder ein paar Tage früher
- 07/2016 | Ökologisch korrekt wird zur Routine
- 07/2016 | Investieren ohne Reue – und dabei Klima und Menschen schützen
- 07/2016 | Planetary Urbanism – Die transformative Kraft der Städte in 50 ausgewählten Arbeiten
- 06/2016 | Rohstoffwende mit Baustoffsteuer und Importzöllen
- 06/2016 | Landgrabbing wird professioneller
- 05/2016 | G7-Staaten stützen Klimawandel weiterhin mit Milliarden für Kohle
- 05/2016 | Bericht zur Lage der Pflanzenwelt: Sterberate bei 20 Prozent
- 05/2016 | Geldgipfel 2016: Von Divestment über Blockchains bis Gemeinwohl
- 05/2016 | Nachhaltige Geldanlagen boomen
- 05/2016 | Handel 4.0 und Slow-Retail: Nachhaltigkeit braucht beides
- 05/2016 | Steuern müssen nachhaltig werden
- 05/2016 | Maßnahmenkatalog für den Klimaschutzplan 2050 vom Umweltbundesamt
- 05/2016 | Das Ende von TTIP ist nah
- 04/2016 | Die Handelsabkommen CETA UND TTIP gefährden europäische Umwelt- und Verbraucherschutzstandards
- 04/2016 | Die Welt zieht in die Städte: Urbanisierung nachhaltig gestalten
- 04/2016 | Handelspolitik könnte nachhaltig sein – wird sie mit TTIP, CETA und Co. aber kaum
- 04/2016 | Ist Googleismus die Chance auf Transformation?
- 03/2016 | Kostenlose Energiemanagement-Software für kleine und mittlere Unternehmen
- 03/2016 | Trotz aller Gewalt: Die Welt wird friedlicher
- 03/2016 | Wasser als Menschenrecht und Waffe: Landwirtschaft und Ernährungsweise sind die Schlüssel zum Wandel
- 03/2016 | Informations- und Kommunikationstechnik verbraucht ein Viertel des Strombedarfs in privaten Haushalten
- 03/2016 | Positive Stromwende-Bilanz fünf Jahre nach Fukushima
- 02/2016 | Frauen leisten 80 Prozent der Sorgearbeit
- 02/2016 | Utopianale: Dokumentarfilmfest lädt nach Hannover
- 02/2016 | Der Elektro-Tata kommt
- 01/2016 | Wie Handeln den Wandel bringt
Themen
- Hürden
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum


