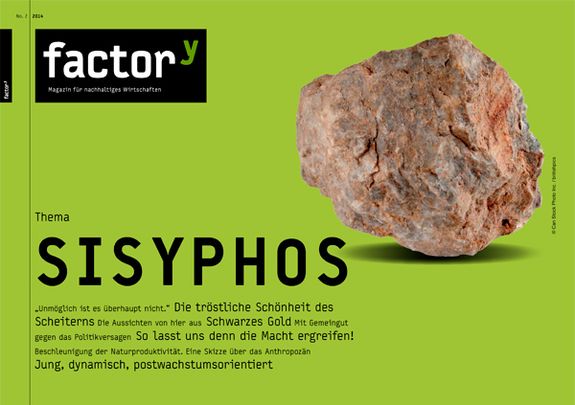Sisyphos

Die tröstliche Schönheit des Scheiterns
In Sachen Nachhaltige Entwicklung können nicht alle Blütenträume reifen. Das darf aber nicht frustrieren, sondern muss ermuntern. Zur Ästhetik und Notwendigkeit des Scheiterns.
Von Bernd Draser
Wir befinden uns im Jahre 16 nach der Bundestags-Enquete-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt, im Jahre 22 nach Rio und der Agenda 21, im Jahre 27 nach dem Brundtland-Bericht, im Jahre 34 der Energiewende-Debatte in Deutschland, im Jahre 42 nach der Grenzen-des Wachstums-Studie, im Jahre 148 des Begriffs Ökologie und bereits im Jahre 301 des Begriffs Nachhaltigkeit. Ganz Deutschland führt das beliebte, aber semantisch ach! so leere Wort im Mund — allen voran die Verantwortung Tragenden. Das klingt nach berechtigter Euphorie.
Bei Menschen aber, die sich seit Jahrzehnten für den Schutz von Ressourcen, Klima und die Förderung nachhaltiger Entwicklungen einsetzen, macht sich Ernüchterung breit, weil trotz des mächtig angeschwollenen Diskurses die wünschenswerten Dinge sich nicht so recht einstellen wollen; allerorten stockt es, fragmentieren sich Entwicklungen, retardieren Unvorhersehbarkeiten hoffnungsvolle Prozesse, formieren sich unerwartete Widerstände von unverhoffter Seite, die frustrieren. Grund genug, einen philosophischen Trost zu versuchen, ausgehend von zwei Mahnungen.
Erste Mahnung: Nachhaltige Entwicklung ist keine Heilsgeschichte
Einige Engagierte in Sachen Nachhaltigkeit denken nach wie vor im Muster von Mahnung und Umkehr, Buße und Errettung. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn in nicht nur einer Hinsicht führt der Nachhaltigkeitsdiskurs theologische Motive fort. Es ist aber der Sache nicht dienlich, mit Schuld und Sühne zu argumentieren, wenn man nicht nur recht behalten, sondern vor allem nachhaltige Lebensstile möglichst vielen Menschen schmackhaft vermitteln will. Der moralische Zeigefinger ist eine denkbar unwillkommene Motivation, vielmehr provoziert er Widerwillen.
Besonders riskant sind alarmistische Krisen- und Katastrophenerzählungen, deren baldige Erfüllung ausbleibt und für Häme bei denen sorgt, die ohnehin nicht daran glaubten. Schlimmer aber ist der Verlust an Glaubwürdigkeit bei denen, die bereit waren, ihr Leben zu ändern. Ein gut belegter Präzedenzfall, dem man viel ablernen kann, ist die frühchristliche Endzeiterwartung, als die Anhänger alle Ereignisse ihrer Zeit als Zeichen der unmittelbar bevorstehenden Wiederkehr Christi deuteten. Die Parusie blieb aber aus, und die Briefe des Apostels Paulus sind in weiten Zügen eine fast Mitleid erregende Anstrengung, dieses Ausbleiben zu rechtfertigen. Daraus wird später eine Ermutigung abzuleiten sein.
Nach der Fukushima-Katastrophe ließ sich unter einigen Atomkraftkritikern eine gewisse Genugtuung wahrnehmen, dass nun doch endlich die oft beschworene Bedrohung sich erfüllt hatte, sogar einigen Politikern rutschten zynische Bemerkungen heraus. Denen erging es also besser als dem wenig sympathischen alttestamentlichen Propheten Jona, der den Bewohnern der Stadt Ninive Umkehr oder Untergang predigte. Er musste enttäuscht feststellen, dass sie wirklich auf ihn hörten und geriet mit Gott in Streit darüber, dass der erhoffte spektakuläre Untergang ausblieb.
Es ist fast zu trivial, um es auszusprechen, aber wer eine nachhaltige Entwicklung will, der will ja gerade das Ausbleiben von Katastrophen, der will die Perspektive auf ein mögliches gutes Leben eröffnen, ein realistisches, ein machbares, ein nahes gutes Leben, aber keine postapokalyptische Hoffnung, die zunächst den Untergang voraussetzt. Nachhaltige Entwicklung bietet keine Sensationen, sondern arbeitet daran, sie zu vermeiden. Unsere Kommunikation muss also bescheidener, milder, freudvoller und vor allem: verführerischer werden!
Zweite Mahnung: Nachhaltiges Agieren ist essayistisch, nicht instrumentell
Nachhaltiges Handeln bedeutet Handeln in Zyklen, in konsistenten, also natürlichen Kreisläufen; die Kreisläufe der Natur sind aber für uns überkomplex und lassen sich nicht ohne weiteres technisch-industriell nachbilden, was wenig überraschen kann, wenn man sich die ungeheure zeitliche Dimension der Evolution vor Augen hält. Teil dieser Zyklen ist auch das Scheitern, das Nichtgelingen; es muss sogar gesagt werden: Zyklisches Denken hat eine Ästhetik des Scheiterns. Und so kann ein Künstler vermutlich Wesentlicheres zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen als ein Prozesschemiker.
In vielfacher Hinsicht ist aber der Nachhaltigkeitsdiskurs immer noch linear und instrumentell geprägt. Man spricht mechanistisch von „Stellschrauben“, „Maßnahmen“, „Instrumenten“ und „Strategien“. Da klingt eine Hybris der Machbarkeit durch, wie sie Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung herausarbeiteten. Wenn die nachhaltige Vernunft aber eine instrumentelle ist, dann muss ihr das zyklische Denken und Agieren wesensfremd bleiben, sie wird immer wieder den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben versuchen.
Wer für eine nachhaltige Entwicklung den allein selig machenden Masterplan entwirft, philosophisch gesprochen, die „Große Erzählung“, kultiviert im Denken jene Monokultur, die er der Landwirtschaft austreiben will. Aber erst wenn dem Nachdenken über Nachhaltigkeit die Monokultur ausgetrieben wird, kann das Scheitern einzelner Versuche, Projekte, Experimente und Insellösungen insgesamt produktiv werden. Anders gesagt: Die Akteure der Nachhaltigkeit müssen ihr Denken vom Strategischen zum Essayistischen umdenken, vom Totalen zum Vorläufigen. Die Textsorte der Nachhaltigkeit muss der Essay sein, nicht die Gebrauchsanweisung – und schon gar nicht die Apokalypse.
Täuschen wir uns nicht! Ein Trostversuch.
Das lateinische Wort „frustratio“ hat einen aktiveren Sinn als der passive deutsche „Frust“, der das Vergebliche der Anstrengung meint. Im Lateinischen klingt die aktive „Täuschung“ stärker mit als die passive „Enttäuschung“. Der Frustrierte ist der „Irregeführte“, der „Gefoppte“ vor allem in der Komödie. Je wichtiger und ernster wir uns selbst nehmen, desto sicherer werden wir zu unfreiwillig komischen Figuren. Das lässt sich vermeiden; blicken wir dazu auf die frühen Christen mit ihrer Endzeiterwartung zurück. Sie waren unfreiwillig komisch, als der Heiland nicht kam. Aber sie begannen, sich mit der Realität zu befreunden, sich im Diesseits einzurichten und für die Welt, in der sie lebten, Verantwortung zu übernehmen. Sie institutionalisierten sich in Rom, sie intellektualisierten sich in Athen, sie adaptierten die Traditionen und Kulturen ihrer Zeit und prägten sie um in ihrem Sinne, und das auf eine beachtliche Dauer – nachhaltig im wörtlichen Sinne.
Eine solche Transformation unserer Kultur und Denkweise steht der Nachhaltigkeit noch bevor; das wird Anstrengungen kosten, das wird vielfaches Scheitern mit sich bringen, aber es stimmt hoffnungsvoll, weil es möglich ist. Und möglich wird es, wenn wir ein Scheitern nicht als einen Rückschlag betrachten, sondern als ein Experiment, das erfolgreich gezeigt hat, was eine Sackgasse ist. Unsere Wissenschaft sollte eine, mit Nietzsche gesprochen, Fröhliche Wissenschaft werden, eine, die nicht eine große Erzählung in die Wirklichkeit hineinprügeln will, sondern eine, die den Versuch, den Essay pflegt.
Der Grundton des Essays ist aber die Heiterkeit, die Freude am Experiment und damit am Scheitern, der Widerstand gegen tierischen Ernst und kalte Instrumentalität. Und die Pointe eines jeden Essays ist der Ausblick auf ein gelingendes, auf ein gutes Leben – nicht als Heilsgewissheit, sondern als beharrliches Versuchen.
Bernd Draser ist Philosoph und lehrt an der Ecosign-Akademie in Köln. Die factory begleitete er schon mit Die Kunst des Trennens, Utopie ist nicht machbar, Herr Nachbar und Freiwillig nur unter Zwang.
Beiträge online
News zum Thema
- 06/2022 | Derzeitige Klimaziele bis 2030 führen zu 2,4 Grad globaler Erwärmung
- 05/2022 | Die vernetzten Krisen erkennen und vernetzt gegensteuern
- 12/2021 | Klimaschutz im Koalitionsvertrag: Ambitioniert, aber nicht genug – besonders bei Gebäuden, Landwirtschaft und Verkehr
- 11/2021 | Ernährung, Gesundheit und Klima zusammendenken
- 07/2021 | Earth Overshoot Day: Die Menschheit verbraucht 1,74 Erden
- 10/2020 | Wie Deutschlands Energiesystem bis 2035 CO2-neutral und das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann
- 10/2020 | Artenverlust wirkt direkt auf das Leben der Menschen
- 09/2020 | UN-Ziele zur Biodiversität: Nach zehn Jahren keines der Ziele erreicht
- 07/2020 | Lieferkettengesetz: Unternehmen müssen ihre globale Produktion sozial und menschengerecht gestalten
- 04/2019 | Deutschlands Klimabilanz 2018: Wegen warmer Witterung 4,2 Prozent weniger Treibhausgasemissionen
- 01/2019 | Agrarpolitik: Subventionen für das Falsche
- 11/2018 | Wie sich das Klimaziel 2030 sicher erreichen lässt
- 08/2018 | Insektenplagen schädigen mit wachsendem Temperaturanstieg mehr Ertrag
- 08/2018 | Erderwärmung könnte in neue „Heißzeit“ führen, weil Rückkopplungen Effekte verstärken
- 06/2018 | Ein Tag des guten Lebens für alle
- 05/2018 | Arbeit hat viele Facetten: Der Atlas der Arbeit zeigt sie
- 01/2018 | Industrie kann Klimaschutz verkraften
- 01/2018 | Satt ist nicht alles
- 01/2018 | Effizienzpreis NRW 2017: Produkt, Prozess oder Konzept?
- 10/2017 | Lasst die Wirtschaftswissenschaft transformativ werden
- 10/2017 | Klimagipfel-Berichterstattung: Kenntnis und Vertrauen wachsen um 20 Prozent
- 09/2017 | Belgien ist besser als Deutschland – in der Wiederverwendung
- 08/2017 | "Ganze Agrarlandschaften könnten vogelleer werden"
- 06/2017 | 30-Hektar-Ziel: Flächenverbrauch für Wohnen und Verkehr liegt bei 66 Hektar pro Tag
- 06/2017 | GLS Bank fordert stärkere Kapitalbesteuerung, Grundeinkommen, CO2-Preis und Abgaben auf Spritz- und Düngemittel
- 05/2017 | Was die Think-Tanks der Welt für die G20-Verhandlungen empfehlen
- 05/2017 | Neue Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 will die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele unterstützen
- 03/2017 | Industrie und Umwelt: Wie geht es weiter im Industrieland NRW?
- 03/2017 | Nachhaltigste Unternehmen, Forschung, Städte, Architektur und StartUps 2017 gesucht
- 02/2017 | Studie: EU muss bis 2030 alle Kohlekraftwerke abschalten, um das Pariser Klimaziel zu erreichen
- 01/2017 | Klimawandel in Europa: Umweltagentur rät zu besserer Vorsorge
- 01/2017 | Für Pariser Klimaziel müssen alte Kohlekraftwerke vom Netz
- 01/2017 | Konzerne der Agrar- und Ernährungsindustrie werden größer und mächtiger
- 11/2016 | Die utopischen Kräfte der Wissenschaft wecken
- 11/2016 | Ressourceneffiziente Produkte günstiger machen
- 11/2016 | Klimakonferenz COP22: Deutsch-marokanische Verhältnisse
- 10/2016 | Europäische und Nationale Ressourcen-Foren vom 9. bis 11. November in Berlin
- 10/2016 | CO2-Steuern würden Emissionen und Ungleichheit senken
- 10/2016 | Investoren haben 26,7 Millionen Hektar Land übernommen
- 09/2016 | Das Anthropozän wird die Naturproduktivität beschleunigen müssen
- 08/2016 | Earth Overshoot Day 2016 wieder ein paar Tage früher
- 05/2016 | Ressourceneffizienz ist ein Wachstumsgeschäft
- 05/2016 | G7-Staaten stützen Klimawandel weiterhin mit Milliarden für Kohle
- 05/2016 | Bericht zur Lage der Pflanzenwelt: Sterberate bei 20 Prozent
- 04/2016 | Ab heute lebt Deutschland auf Pump
- 04/2016 | 2015 erstmals mehr als 400 ppm CO2 in der Atmosphäre
- 04/2016 | Indien plant bis 2030 alle Autos auf Elektomotoren umzustellen
- 03/2016 | Trotz aller Gewalt: Die Welt wird friedlicher
- 03/2016 | Positive Stromwende-Bilanz fünf Jahre nach Fukushima
- 02/2016 | Utopianale: Dokumentarfilmfest lädt nach Hannover
- 01/2016 | Wissenschaftler warnen vor noch schnellerer Erderwärmung, wenn nicht rasch gehandelt wird
- 01/2016 | Vielfalt ist wirklich produktiver
- 12/2015 | Regierung tut zu wenig für die Lobbytransparenz
- 12/2015 | Klimagipfel: "Ziel ist Null-Emissionen bis 2070"
- 11/2015 | Neuer Höchststand bei den Treibhausgasen
- 10/2015 | EU-Parlament will Höchstgrenzen für Luftschadstoffe
- 02/2015 | Ideen für die Stadt von morgen im Bürgertest
- 09/2014 | Erst durch Suffizienz wird Elektromobilität sinnvoll
- 08/2014 | Kein Land mehr für Kohle
- 06/2014 | Dem Frust keine Chance
Themen
- Hürden
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum