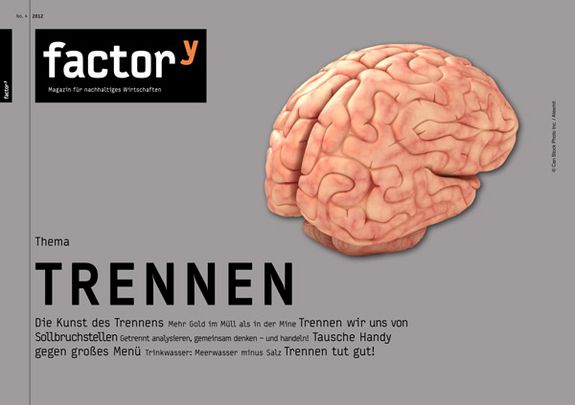Trennen

Trennen wir uns von Sollbruchstellen

Viele Produkte unseres Alltags könnten ein längeres Leben haben, wären sie entsprechend gestaltet. An der Folkwang-Hochschule der Künste entwickeln Designer dazu neue Ideen: Über das Trennen von Material, getrennte Module und lösbare Verbindungen.
Von Anke Bernotat und Judith Schanz
Es passiert immer häufiger: Das neueste Mobiltelefon gehört schon nach einem Jahr zum alten Eisen. Nicht wegen seiner Gestalt, sondern weil immer weniger daran funktioniert. Der Akku lässt nach, ist leider auch nicht austauschbar, die Tasten klemmen, der Glas-Screen ist gesprungen, die Reparatur fast so teuer wie ein Neugerät.
Doch nicht nur Mobiltelefone sind anfällig. Immer früher müssen wir uns auch von Schuhen, Fahrradlampen oder Elektroartikeln jeglicher Art trennen, weil wir die Produkte weder selber reparieren noch reparieren lassen können: Kompetente Handwerksbetriebe sind verschwunden, Elektrofachmärkte tauschen die Produkte im Garantiefall ganz aus oder verkaufen lieber neu.
Nutzer – und Produzenten – müssen sich fragen: Sind heutige Produkte einfach zu wenig sorgsam entwickelt oder auch einfach zu billig hergestellt? Haben wir Nutzer – und Produzenten – verlernt, unsere Produkte zu achten, sorgfältig zu nutzen und sie reparieren zu lassen – oder reparaturfähig zu gestalten? Welche Möglichkeiten bietet Design, um ein viel zu frühes Trennen von Produkten und Nutzern zu verhindern?
Die meisten Konsumgüter werden von Industriedesignern gestaltet. Ihre Rolle ist zentral, wenn relevante, langlebige und damit nachhaltige Produkte entstehen sollen. Mit der Auswahl von High-Tech- und/oder Low-Tech-Technologie, Materialien und Fertigungsverfahren können Gestalter Konzepte generieren, um die Lebensdauer von Produkten erheblich zu verlängern und somit ein frühzeitiges Trennen von eigentlich noch völlig brauchbaren Gegenständen und wertvollen Rohstoffen zu verhindern.
Das Thema Trennen ist dabei für Designer in vieler Hinsicht interessant, wie mehrere Arbeiten aus dem Studiengang „Industrial Design an der Folkwang Universität der Künste zeigen.
Im Trennen liegt der Nutzen
Konzentrieren sich Designer auf den Nutzen und gehen methodisch vor, können sie selbst traditionelle Trennwerkzeuge nutzerfreundlicher und langlebiger gestalten. Sabet Regnery entwarf dabei eine Spaltaxt nach dem Vorbild einer traditionellen japanischen Axt für Zimmermänner. Ihre Axt zeichnet sich durch den langen Bart und die lange Schneide aus. Dadurch entsteht ein deutlich längerer Spalt als bei herkömmlichen Modellen, das Holz lässt sich einfacher spalten. Der Nutzer lässt die Axt nur von seiner Kopfhöhe fallen, um mit deren Eigengewicht das Holz zu spalten. Durch Verwendung extrem robuster Materialien nutzt sich die Axt kaum ab.
„Unibble“, ein weiteres innovatives Trennwerkzeug, hilft Kindern beim Kürzen ihrer Fingernägel. Der Entwurf von Steffen Kauenhowen berücksichtigt, dass die Fingernägel von Kindern noch sehr weich sind und ihnen durch herkömmliche Nagelknipser oft Schmerzen entstehen. „Unibble“ bietet Kindern eine sichere und verständliche Möglichkeit, die eigene Nagelpflege zu lernen.
Die Bilder zu den Produkten finden Sie in unserem PDF-Magazin factory Trennen.
Trennbarkeit verlängert Leben
Reparierbarkeit ist ein großes Thema bei der Schaffung nachhaltiger Produkte. Ist ein Produkt in seine Einzelbestandteile zerlegbar, kann es besser repariert werden. Leider achten Hersteller in ihrer Produktentwicklung und im Engineering zu wenig auf die Trennbarkeit von Einzelteilen. Sie verhindern damit die Reparaturfähigkeit vieler, alter Produkte. Dabei kann durch einfachen Austausch einzelner defekter Elemente ihre Lebenszeit von oft kaum einem Jahr erheblich verlängert werden. Das Motto für Designer lautet deshalb „Rethink Research Repair“, wie im Projekt „Innovation und Gestaltung“ in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut UMSICHT. In einem Repairworkshop entdeckten die Studierenden, dass viele Elektrogeräte nur aufgrund kleinerer Mängel „ihren Geist aufgeben“. Häufig sind lediglich Kontakte verschmutzt, Kabel nicht robust genug oder Akkus sehr kurzlebig oder nicht austauschbar.
Integrieren Designer den modularen Aufbau in den Nutzen, entstehen dabei auch reparaturfähige und nachhaltige Produkte. So ließ sich der Handstaubsauger von Vanessa Hapke wirklich schlecht reinigen. Der Filter verschmutzte, ein Ersatzfilter kostet fast den Neupreis des Gerätes und war nicht gut austauschbar gestaltet, das Gerät verstopfte und „starb“. In ihrer Arbeit konzentrierte sich die Studentin daraufhin auf die Entwicklung eines komplett zerlegbaren Handstaubsaugers mit Universalakku. Dessen Ersatzteile sind problemlos im Handel erhältlich und sehr einfach einzubauen.
Viele noch reparaturfähige Produkte landen auf dem Müll, weil Nutzer zu bequem geworden sind, defekte Geräte zur Reparatur einzusenden. Zudem unterstützen niedrige Neupreise die vorzeitige Trennung. Ronja Hasselbach stellte fest, dass eine Bekannte fast jährlich eine neue Kaffeemaschine kauft. Die angehende Designerin fand heraus, dass die Kaffeemaschine umständlich und nicht sorgfältig konstruiert war. Sie trennte die einzelnen Funktionen der Kaffeemaschine auf: Wasser erhitzen, Wasser pumpen, Kaffee aufbrühen. Daraus entwickelte die Studentin ein modular aufgebautes Kaffeebrühkonzept. Das ist weniger anfällig für Defekte. Und sollte doch einmal etwas kaputt gehen, ist jedes Modul sehr gut zugänglich und kann unkompliziert repariert oder ausgetauscht werden.
Izabella Rudic fiel auf, dass bei Rücksäcken aller Art die Reisverschlüsse als erstes Element versagen. Zudem sind sie nur teuer oder mit Fachkenntnis zu reparieren. Ihre Lösung: „Keepe“, ein Rucksack ganz ohne Reisverschluss. Jeder Benutzer kann so sein Produkt ohne Spezialkenntnisse selbst reparieren. Die neue Verschlusstechnik macht den Rucksack außerdem zum individuellen Produkt, das an die verschiedensten Situationen angepasst werden kann. So bekommt ein profanes Alltagshilfsmittel mehr Persönlichkeit – und der Nutzer will sich nicht mehr von ihm trennen.
Doch nicht nur über einen modularen und zugänglichen Aufbau können Designer die Funktion von Produkten lange erhalten. Wird die Funktion von einem Produkt getrennt, können dessen Ausgangswerkstoffe auch eine neue Verwendung und selbst ausgediente Produkte ein zweites Leben erhalten.
Wie bei „RELOAD“, einem von Phillip Kaeppele entwickelten Stereokopfhörer, der aus alten Vinyl-Schallplatten gefertigt wird. Jeder „RELOAD“ ist ein Unikat und erhält sein charakteristisches Aussehen über die Farben und Beschriftungen der verwendeten Platten. Die Kopfhörer können so per Blaupause selber zusammengebaut werden. Wer handwerklich weniger begabt ist, kann diese auch als Service übers Internet bestellen. Geliebte Platten werden so vor dem Entsorgen bewahrt und die Vinyls bekommen wenigstens im zweiten Leben eine sinnvolle Funktion. Auch die Verpackung von „RELOAD“ ist ein Upcyclingprodukt. Zwei Plastiktüten werden miteinander verschmolzen und liefern so eine einzigartige Hülle, die „RELOAD“ beim Transport schützt.
Kaputt ist nicht kaputt: Selina Strunk ärgert sich über die immer schneller verschleißenden Nylonstrumpfhosen, die zahlreich auf dem Müll landen. Deshalb gründete sie das Label „Eli Hetti“, das Schuhe aus kaputten Nylonstrümpfen anbietet und sogar Evonik als Partner in der Materialentwicklung gewinnen konnte. Überzeugen Sie sich selbst: Wer kommt schon darauf, dass diese wunderbaren Schuhe aus Nylons bestehen?
Nutzer und Produkt – ein unzertrennliches Paar
Kein Produkt ohne Materialien. Produkte benötigen zwangsläufig wertvolle Ressourcen. Um diese mindestens sinnvoll und nachhaltig zu nutzen, sind Gestalter gefragter denn je. Der Nutzer soll möglichst lange, am besten ganz, davon abgehalten werden, sich von seinen Produkten zu trennen.
Dazu benötigen Produkte Wertschätzung und Anerkennung. Geht ein Produkt eine Bindung mit dem Nutzer ein, sei es aufgrund einer Funktion oder einer Emotion, wird der Nutzer sich verantwortlich kümmern.
Die vorgestellten Arbeiten machen exemplarisch deutlich, welche unterschiedlichen Wege Designer gehen können, damit wir Nutzer eine gesunde Beziehung zu den Produkten aufbauen können. Gestalter können herkömmliche Werkzeuge vereinfachen. Sie können durch einen modularen Aufbau die Trennung in Einzelteile ermöglichen, um defekte Teile unkompliziert austauschen und reparieren zu können. Gestalter können die Funktion von Produkten trennen, um so die wertvollen Werkstoffe für neue Funktionen zu verwenden und ihnen ein längeres Leben zu ermöglichen.
Im Hinblick auf die schwindenden Ressourcen unserer Erde haben Gestalter die Aufgabe, für relevante und sinnvolle Produkte zu streiten – und diese so durchdacht wie möglich mit Materialien auszustatten. Denn Produkte müssen bedingungslos überzeugen, damit der Nutzer mit ihnen eine unzertrennliche Beziehung eingeht.
Die Bilder zu den Gestaltungsideen finden Sie in unserem PDF-Magazin factory Trennen.
Anke Bernotat ist Designerin und Professorin für Industrial Design – Konzeption und Entwurf – an der Folkwang Hochschule der Künste in Essen. Judith Schanz ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Weitere Beiträge zum Thema Trennen mit erläuternden Zahlen und Zitaten, schön illustriert und gut lesbar auf Bildschirmen und Tablets in unserem PDF-Magazin Trennen.
Beiträge online
News zum Thema
- 07/2021 | Earth Overshoot Day: Die Menschheit verbraucht 1,74 Erden
- 06/2021 | Umfrage zur Circular Economy: Begriff kaum bekannt, aber Handy-Pfand, Rohstoffreduzierung und Recyclingprdukte erwünscht
- 07/2020 | Zukunft Für Alle-Kongress mit über 200 Veranstaltungen zu Utopien und Transformation
- 04/2019 | Deutschlands Klimabilanz 2018: Wegen warmer Witterung 4,2 Prozent weniger Treibhausgasemissionen
- 03/2019 | Globale UN-Vereinbarung gegen Plastikmüll gefordert
- 11/2018 | Wie sich das Klimaziel 2030 sicher erreichen lässt
- 05/2018 | Arbeit hat viele Facetten: Der Atlas der Arbeit zeigt sie
- 01/2018 | Effizienzpreis NRW 2017: Produkt, Prozess oder Konzept?
- 10/2017 | Lasst die Wirtschaftswissenschaft transformativ werden
- 06/2017 | Geht doch: Handelsketten produzieren Textilien mit weniger Gift – aber noch immer ohne Konzept zur Suffizienz
- 05/2017 | Neue Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 will die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele unterstützen
- 03/2017 | Nachhaltigste Unternehmen, Forschung, Städte, Architektur und StartUps 2017 gesucht
- 01/2017 | Für Pariser Klimaziel müssen alte Kohlekraftwerke vom Netz
- 10/2016 | Europäische und Nationale Ressourcen-Foren vom 9. bis 11. November in Berlin
- 03/2016 | Kohlendioxidreduktion durch Lithium-Akkumulatoren?
- 02/2016 | Kamikatsu – die Stadt die keinen Müll produzieren will
- 02/2016 | Biologisch abbaubares Plastik löst das Problem nicht
- 04/2015 | TV-Tipp: Wie öko sind Getränkekartons von Tetra Pak & Co?
- 03/2014 | Gender-Pay-Gap: Frauen verdienen 20 Prozent weniger
- 03/2014 | Kreatives Design auf guter Messe
- 01/2014 | Soziales Smartphone: Das erste Fairphone im Test
- 08/2013 | NRW-Atlas zum nachhaltigen Einkaufen
- 07/2013 | Trinkwasser aus dem Meer – neues Verfahren
- 05/2013 | Wertewandel: Fairphone statt iPhone 5S und Galaxy S5
- 05/2013 | Umweltschutz im Kopf, doch nicht unbedingt
- 04/2013 | Den Rucksack von Mobiltelefonen weiter nutzen
- 04/2013 | Seriell Individuell: Handwerk im Design
- 03/2013 | Wie Handy-Recycling gelingen kann
- 03/2013 | Mehr ressourcenschonende statt ressourcenfressende Produkte
- 03/2013 | Verantwortungsvoll konsumieren lernen
- 03/2013 | CEBIT 2013: BUND/Forsa-Umfrage zu Umweltaspekten von Computern
- 02/2013 | Trennen fürs Trinken
- 01/2013 | Stressreport 2012: Subjektive Belastung steigt
- 01/2013 | Gemeinsam statt in getrennten Disziplinen
- 01/2013 | Die Kunst des Trennens
- 12/2012 | Verbindendes Trennen
Themen
- Hürden
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum